
Filmkamera-Datenblätter
BOLEX H16 M-5 / RX-5 / SB / SBM
|
Diese Seite verwendet Cookies sowie die Tracking-Software Matomo. Mit der weiteren Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Details hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung. Abschalten können Sie das Tracking hier. Möglicherweise sind die Inhalte dieser Seite technisch veraltet, verbleiben aber aus Archivgründen im Netz. Aktuelle Informationen sowie die Möglichkeit Fragen zu stellen, finden Sie unter www.frag-den-neudeck.de |
|
Startseite Frag' den Neudeck Impressum Tracking Datenschutzerklärung |

Die folgenden Kamerabeschreibungen bauen chronologisch aufeinander auf, so dass Sie normalerweise den gesamten Text lesen sollten. Um Ihnen die Suche nach einer speziellen Information zu erleichtern, finden Sie hier trotzdem Sprungmarken zu den wichtigsten Textabschnitten:
| Die grundlegenden Bedienelemente | Die Elektromotoren | ||
| Das optische System | Die Umlaufblende | ||
| Die Objektive | Die inneren Bedienelemente | ||
| Der Federwerkmotor | Film einlegen |
Die Kameras sind sich in ihrer Grundstruktur so ähnlich, dass sie in dieser Beschreibung problemlos gemeinsam behandelt werden können. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch die Art der Objektivaufnahme und der Möglichkeit, 120 m-Filmkassetten verwenden zu können.
Die Kameraausstattung lässt sich am Namen ablesen:
"B" zeigt an, dass die Kamera mit einer Bajonett-Objektivfassung ausgestattet ist.
"M" steht für die Möglichkeit, neben der kamerainternen 30 m Tageslichtspule, auch ein 120 m-Zusatzmagazin ansetzen zu können.
"R" bezeichnet Kameras, die mit einem Objektivrevolver (3 x C-Mount) ausgestattet sind.
"S" steht für "Spring", also für Federwerk, wobei hier die Kennzeichnung aus historischen Gründen nicht durchgängig ist. Auch die alten Bolex H16 M-5- und H16 RX-5-Modelle sind federwerkgetrieben.
"X" zeigt an, daß es sich um eine Kamera mit eingebautem Reflexsucher handelt, wobei auch hier die Kennzeichnung uneinheitlich ist. Hier sind es die neueren Modelle Bolex H16 SB und H16 SBM, die aus der Reihe tanzen. Sie sind nur mit Reflexsucher erhältlich.
Die meisten Modelle gibt es noch in einer Sonderversion, die auf dem Typenschild die Zusatzbezeichnung "Matic" trägt. Sie steht für die Ausstattung mit einer Überblendautomatik.
Alle Kameras dieser Baureihe zeichnen sich besonders durch Ihre zahlreichen Trickmöglichkeiten aus, die man im professionellen Sektor sonst allenfalls an speziellen Trickfilmkameras (z.B. von Crass) findet.
Neben der Einzelbildschaltung, für die sich zahlreiche Anwendungen finden lassen, ist die Möglichkeit, den Film manuell zurückzuspulen, besonders interessant. In Verbindung mit einem Kompendium und den entsprechenden Masken, lassen sich so zahlreiche Tricks aus den Kindertagen des Kinos nachvollziehen: Bildteilungen und -Überlagerungen, Doppelgängeraufnahmen und vieles mehr.
| Die grundlegenden Bedienelemente |
Die Darstellung erfolgt am Beispiel der Kamera Bolex H16 SBM. Soweit erforderlich, sind relevante Abweichungen zu anderen Kameratypen an entsprechenden Stellen näher erläutert.
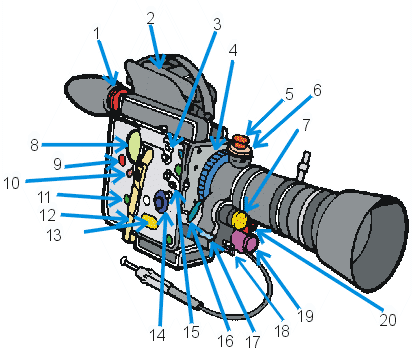
HINWEIS: Damit Sie im weiteren Verlauf des Textes nicht immer zur Grafik zurückscrollen müssen, können Sie sich durch einen Klick auf die Pfeilnummer, beispielsweise (12), ein zusätzliches Grafikfenster anzeigen lassen.
| 1 | Einstellring für den Dioptrienausgleich |
| 2 | Ansatzstelle für eine 120 m Zusatzkassette. Bei Nichtgebrauch befindet sich hier eine Lichtschutzabdeckung (Betrieb nur in Verbindung mit einem Elektromotor möglich) |
| 3 | Bildzählwerk |
| 4 | Bajonett-Objektivanschluss (auf der Abbildung mit Objektiv KERN Vario-Switar 100, 16 - 100 mm f 1,9 mit integrierter Belichtungsmesseinrichtung). Bei Kameras mit Objektivrevolver befindet sich hier die drehbare Grundplatte mit drei C-Mount-Anschlüssen. |
| 5 | Einstellskala des Belichtungsmessers zur Einstellung der Filmempfindlichkeit (nur bei Kameras mit KERN Vario-Switar 100) |
| 6 | Einstellskala zur Justage des Belichtungsmessers auf die an der Kamera eingestellte Bildfrequenz. WICHTIG: Bei jedem Wechsel der Bildfrequenz an der Kamera (14) muss der Wert auch hier unbedingt korrigiert werden. Andernfalls sind Fehlbelichtungen die Folge! |
| 7 | Blendenanzeige und Einstellrad für die manuelle Bedienung (nur bei Kameras mit KERN Vario-Switar 100) |
| 8 | Schwenkhebel zur Auskupplung des Federwerkmotors |
| 9 | Zählwerk für den Filmmaterialverbrauch |
| 10 | Auslöser für die Überblendeinrichtung (nur bei Kameras mit dem Zusatz "Matic" in der Typenbezeichnung) |
| 11 | Befestigungspunkt für Zubehör. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die auf der Grafik im gleichen dunklen Grünton dargestellt sind. |
| 12 | Kurbelarm (der Kurbelgriff verschwindet in Ruhestellung unter dem Kameragehäuse) zum Spannen des Federwerkmotors. |
| 13 | Wahlschalter zur Auswahl von Dauerlauf oder Einzelbildaufnahme (nur bei Federwerkbetrieb) |
| 14 | Wahlschalter für die Bildfrequenz. WICHTIG: Nicht vergessen, gegebenenfalls auch am Belichtungsmesser des Objektivs (6) eine Neujustage vorzunehmen! |
| 15 | Herausführung der Antriebswelle (1 Umdrehung je Bild) zum Anschluss eines Elektroantriebes, direkt links daneben, die Herausführung der Welle zum manuellen Rückwickeln des Films. Auf der Grafik nicht zu erkennen: der Verstellhebel für die Umlaufblende |
| 16 | Hebel zur Einstellung des kamerainternen Gelatinefilters, darunter (in der Grafik nicht sichtbar): der Ein-/Ausschalter für den Kameralauf (nicht bei Verwendung des KERN Vario-Switar 100) |
| 17 | Wippe zur motorischen Verstellung der Brennweite (nur bei Kameras mit KERN Vario-Switar 100) |
| 18 | Ein-/Ausschalter für den Kameralauf mit gleichzeitiger Auslösung der Springblende (nur bei Kameras mit KERN Vario-Switar 100) |
| 19 | Batteriefach für Belichtungsmesser (nur bei Kameras mit KERN Vario-Switar 100) |
| 20 | Batterie-Kontrolle für Belichtungsmesser (nur bei Kameras mit KERN Vario-Switar 100) |
| Das optische System |
Im Gegensatz zu den meisten professionellen Filmkameras, sind die Bolex H16-Modelle (außer H16 M-5, die keinen Reflexsucher besitzt) mit einem Strahlenteilerprisma ausgestattet. Dieses liegt hinter dem Objektiv und zweigt etwa 25 % des einfallenden Lichts für den Sucher ab. Hierdurch wird während der Aufnahme das von anderen Kameras bekannte Sucherflimmern vermieden.
| Nachteil dieser Konstruktion ist der
damit zwangsweise verbundene Lichtverlust auf dem Film.
Dieser muss bei der Belichtungsmessung berücksichtigt
werden. Objektive mit eingebautem Belichtungsmesser, welche für die Bolex hergestellt wurden, berücksichtigen den Lichtverlust, so dass der an der Kamera eingestellte Bildfrequenzwert nur auf die Skala des Objektivs übertragen werden muss. Etwas komplizierter wird es bei Verwendung eines Handbelichtungsmessers. Das bei anderen Geräten übliche Übertragen der an der Kamera eingestellten Bildfrequenz auf den Index des Belichtungsmessers führt unweigerlich zu Fehlbelichtungen! Die für die einzelnen Bildfrequenzen am Belichtungsmesser einzustellenden Zeiten sind der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen (jeweils bei voller Öffnung der Umlaufblende). |
|
||||||||||||||||
Zwischen Objektiv und Strahlenteiler befindet sich eine Filterschublade, in die eines der üblichen Gelatinefilter eingesetzt werden kann. Wird für eine Aufnahme kein kein Filter benötigt, kann es trotzdem in der Halterung verbleiben. Die Filterschublade wird in diesem Fall bis zu ersten Raste herausgezogen und mit dem kleinen Arm (16) arretiert. Auch wenn kein Filter benutzt wird, muß eine Filterschublade eingeschoben und korrekt eingerastet sein. Andernfalls ist mit erheblichem Fremdlichteinfall zu rechnen!
Die Mattscheibe ist direkt auf eine Seite des Strahlenteilers geätzt und ist nicht austauschbar. Die Einzeichnungen können von Kamera zu Kamera unterschiedlich sein, manchmal ist auch gar nichts eingezeichnet. Bei Kameras jüngeren Baujahres ist jedoch oft das TV-Bild graviert.
Die Reinigung des Strahlenteilers erfolgt durch die Objektivfassung. Es lässt sich leicht nach vorne herausziehen, so daß auch die rückwärtigen Seiten zugänglich sind. Bei Arbeiten am Strahlenteiler ist äußerste Vorsicht angebracht, denn schon eine leichte Beschädigung der Oberfläche führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bildqualität auf dem Film.
Das Sucherokular vergrößert das Mattscheibenbild 14-fach und ist mit einem Dioptrienausgleich (1) versehen. Zur Justage muss zunächst der obere Feststellring gelockert werden. Erst dann kann der untere Einstellring verdreht werden. Am präzisesten ist die Einstellung, wenn ohne eingesetztes Kameraobjektiv auf das Korn der Mattscheibe schafgestellt wird.
Für besondere Anwendungszwecke oder wenn der Okulardurchblick nur mühsam möglich ist (beispielsweise beim Einsatz am Tricktisch), kann das Okular gegen eine kleine Videokamera ausgetauscht werden.
| Die Objektive |
Die Objektivbestückung ist vom Kameratyp abhängig. Kameras mit Revolverkopf besitzen drei C-Mount-Objektivanschlüsse und sind so zu Objektiven vieler Hersteller kompatibel. Häufig wird man die folgende Bestückung vorfinden:
KERN SWITAR 10 mm f 1,16
KERN MACRO SWITAR 26 mm f 1,1
KERN MACRO SWITAR 75 mm f 1,19
Kameras mit Bajonettfassung sind meist mit dem auf der Abbildung dargestellten KERN VARIO SWITAR 100 POE bestückt. Das Kürzel "POE" steht für "Power-Zoom", "Open-Stop" und "Electric-Eye".
Der mit dieser Optik verfügbare Zoombereich liegt zwischen 16 und 100 mm und wird über eine kleine Wippe (17) motorisch verstellt. Die Geschwindigkeit des Zooms ist über den gesamten Brennweitenbereich konstant und ist nicht regelbar. Gespeist wird der Motorantrieb durch zwei Batterien vom Typ Mallory RM 1 ("blauer Ring"). Das Batteriefach ist auf der Zeichnung nicht sichtbar, befindet sich aber etwa auf der Höhe des Batteriefaches für den Belichtungsmesser (19), jedoch auf der anderen Seite.
"Open-Stop" bedeutet, dass sich die Objektivblende durch leichten Druck auf den Auslöser auf ihren größten Wert öffnen lässt und so eine genaue Schärfenbeurteilung ermöglicht. Alternativ kann diese Springblenden-Automatik auch über einen Drahtauslöser oder über den als Kamerazubehör erhältlichen Handgriff ausgelöst werden.
"Electric-Eye" ist die blumige Umschreibung für die ins Objektiv integrierte Belichtungsmesseinrichtung. Die Messung erfolgt durch das Objektiv.
Da sich die Belichtungsmesszelle in der Optik und nicht, wie bei den meisten anderen Geräten, im Kameragehäuse befindet, werden bei der Messung nur vor der Frontlinse angebrauchte Filter berücksichtigt. Für Filter, die sich in der kameraeigenen, hinterlinsigen Filterschublade befinden, muss der Belichtungswert manuell korrigiert werden.
Zur Einstellung der Filmempfindlichkeit muss der Skalenring (5) angehoben und in entsprechender Richtung verdreht werden. Nach gleichem Prinzip wird dem Belichtungsmesser die Laufgeschwindigkeit und damit die Belichtungszeit der Kamera übermittelt. Die Einstellmarke hierfür (6) weist drei verschiedene Positionen auf: Jeweils eine für die voll geöffnete Sektorenblende, eine für die halbgeöffnete Sektorenblende und "E", welche bei bei dieser Kamera nicht zum Einsatz kommen darf (Gefahr von Fehlbelichtungen)!
Zum manuellen Einstellen eines Blendenwertes muss der Ring (7) angehoben und bis zum Anschlag gedreht werden. Die Automatik ist nun deaktiviert, und es kann durch Drehen am Blendenring jede beliebige Blende eingestellt werden.
Die Belichtungsmessbatterie (Mallory PX 1 "gelber Ring") befindet sich unterhalb des Objektivs (19) und muss ausgetauscht werden, wenn der Zeiger des Belichtungsmessers bei Betätigung des Batterie-Test-Knopfes (20) unter den Wert 16 abfällt.
Weitere, besonders für diese Kamera geeignete Objektive sind das KERN VARIO-SWITAR 12,5 - 100 f 2, (mit Springblende jedoch ohne Belichtungsmesser) und das KERN VARIO-SWITAR Compact 17 - 85 mm f 3,5, welches sehr kompakt gebaut ist. Objektive mit C- und Arri-Fassung lassen sich über einen geeigneten Adapter ebenfalls anschließen.
Vorsicht geboten ist bei hochöffnenden Festobjektiven mit Brennweiten unter 50 mm. Diese sollten das Kürzel "RX" tragen. RX-korrigierte Objektive sind speziell für die Verwendung in Verbindung mit einem Strahlenteilerprisma gerechnet.
Der Objektivwechsel ist einfach. Zunächst wird der Überwurfring (4) gelöst. Die Optik lockert sich, kann aber nicht herausfallen. Erst durch Betätigen des Entriegelungsknopfes, welcher sich unterhalb der Objektivfassung befindet, lässt sich der Ring voll öffnen und die Optik entnehmen. Das Einsetzen des neuen Objektivs ist ähnlich einfach.
| Der Federwerkmotor |
Am besten nach jeder Aufnahme sollte der interne Federwerkmotor mit Hilfe der in der Kamera integrierten Handkurbel (12) aufgezogen werden. Andernfalls ist die Gefahr groß, dass die Kamera mitten in einer wichtigen Einstellung ihren Dienst versagt. Nach 22 vollen Umdrehungen (gegen den Uhrzeigersinn) ist die Feder gespannt. Der Motor zieht damit ganze 4,8 m Film durch die Kamera.
Die Bildgeschwindigkeit kann vorgewählt werden (14): Frequenzen von 12, 16, 18, 24, 32, 48, und 64 B/Sek. sind möglich. Zusätzlich können Einzelbilder aufgenommen werden.
| Die Elektromotoren |
Bei Betrieb mit externem Motor erfolgt die Einstellung der gewünschten Laufgeschwindigkeit nicht an der Kamera, sondern am jeweiligen Motor.
Beim Wechsel von Federwerk auf Elektromotor muss zunächst die Kurbel (12) abmontiert und das Federwerk am Hebel (8) ausgekuppelt werden. Sollte sich der Motor noch immer nicht an die Kamera ansetzen lassen, so ist der Kameraauslöser (16 bzw. 18) nicht ordnungsgemäß eingerastet.
Von Bolex selbst gibt es gibt es drei geeignete Antriebsmotoren:
EM-Motor (12 Volt): Hierbei handelt es sich um einen mechanisch geregelten Fliehkraftmotor, der sich in einem Bereich von 16 bis 25 B/Sek. regeln lässt.
ESM-Motor (12 Volt): Dieser Motor besitzt eine elektronische Regelung und ermöglicht die Vorwahl der folgenden Bildfrequenzen: 10, 18, 24, 25 und 50 B/Sek. Mit Hilfe einer externen Quarzsteuerung oder auch mit dem anschließbaren Pilottongerät werden Tonaufnahmen möglich (wenn das Betriebsgeräusch der Kamera nicht stört).
Single Frame Unit 3: Dieser universell versorgbare Einzelbildmotor (Wechselstrom 105 - 120 V oder 210 bis 240 V, 50 oder 60 Hz, Gleichstrom 15 - 30 V) wird gemeinsam mit einem Zeitraffersteuergerät geliefert, welches umfangreiche Einstellmöglichkeiten bietet. Neben der reinen Intervallschaltung (1 Bild alle 1 bis 9999 Sek. = 2 Std. 46 Min.) ist auch die Vorwahl einer bestimmen Anzahl von Bildern, die belichtet werden sollen, möglich.
Weiterhin gibt es von zahlreichen Fremdherstellern Motoren für unzählige Spezialaufgaben. Auch Eigenbauten von Kameraleuten hat es schon gegeben. Bei der Kalibrierung solcher Motoren ist zu berücksichtigen, daß die Kamera mit jeder Umdrehung der Antriebswelle um ein Bild weiterschaltet.
| Die Umlaufblende |
Die Umlaufblende ist auch während des Kameralaufs stufenlos zwischen 0° und 135° verstellbar. Der Hebel hierfür, auf der Grafik nicht erkennbar, liegt oberhalb der Herausführung für die Antriebswelle (15).
| Dadurch können bereits in der Kamera
Auf- und Abblenden realisiert werden. Durch die Möglichkeit,
den Film über eine Kurbel manuell zurückzuwickeln, ist
auch eine Überblendung zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Szenen möglich. Kameras mit dem Zusatz "Matic" können die Umlaufblende zu diesem Zweck automatisiert öffnen oder schließen. Für andere Typen gibt es den an der Kamera montierbaren RX-Fader als Zubehör, der den gleichen Zewck erfüllt. |
|
||||||||||
Auf Wunsch kann der Steuerhebel in bestimmten Positionen arretiert werden (siehe Tabelle). Bei geschlossener oder halbgeschlossener Sektorenblende erscheint eine Warnanzeige im Sucher.
Aufgrund des ungewöhnlichen Hellsektors von 135°, ist die Kamera nicht für Aufnahmen unter konventionellem HMI-Licht geeignet. Auch bei externer Belichtungsmessung ist Vorsicht geboten, denn hier darf nicht mit dem rechnerisch aus Bildfrequenz und Hellsektorwinkel ermittelten Zeitwert gearbeitet werden (siehe Hinweise unter " Das optisches System").
| Die inneren Bedienelemente |
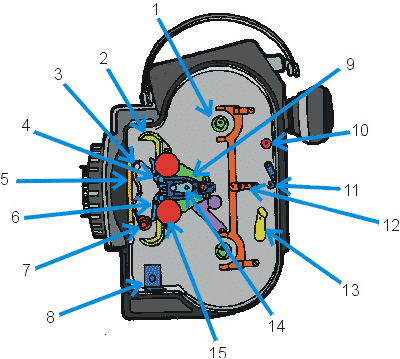
HINWEIS: Damit Sie im weiteren Verlauf des Textes nicht immer zur Grafik zurückscrollen müssen, können Sie sich durch einen Klick auf die Pfeilnummer, beispielsweise (12), ein zusätzliches Grafikfenster anzeigen lassen.
| 1 | Dorn für die Abwickelspule. Der Dorn für die Aufwickelspule ist im unteren Bereich der Kamera sichtbar und ist in der gleichen Farbe markiert. Bei Einsatz mit 120 m Zusatzkassette muß auf jeden Dorn eine Umlenkrolle gesteckt werden, andernfalls sind Filmschrammen unvermeidlich! |
| 2 | Oberer Schlaufenformer. Der untere Schlaufenformer liegt ihm gegenüber und ist in der gleichen Farbe dargestellt. |
| 3 | Knopf zum Lösen der Filmandruckplatte |
| 4 | verriegelbare Andruckkufe für die obere Zahntrommel (der schwarze Punkt stellt den Verriegelungsknopf dar). |
| 5 | Filmandruckplatte |
| 6 | verriegelbare Andruckkufe für die untere Zahntrommel (der schwarze Punkt stellt den Verriegelungsknopf dar). |
| 7 | Schraube zum Entfernen der Filmandruckplatte |
| 8 | Filmschneidemesser für den richtigen Anschnitt des Filmmaterials |
| 9 | Arretierungsschieber für Andruckkufen |
| 10 | Hebel zum Ein- /Ausschalten des akustischen Szenenlängensignals. Bei eingeschaltetem Signalgeber gibt die Kamera im Sekundenabstand (bei 24 B/Sek) ein klickendes Signal von sich. |
| 11 | Rückstellung für das Filmzählwerk |
| 12 | Spulenauswerfer |
| 13 | Führungsarm für die untere Spule |
| 14 | Hebel für Schlaufenformer |
| 15 | Untere Zahntrommel. Die obere Zahntrommel ist in der gleichen Farbe dargestellt. |
| Film einlegen |
Am Anfang sei empfohlen, die Vorgänge zunächst mit einer Rolle Filmabfall zu üben.
Einlegen der 120 m Zusatzkassette
Ansetzen der Kassette an die Kamera
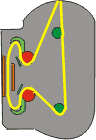 Öffnen
Sie die beiden Andruckkufen (4 und 6) und arretieren
sie diese, indem sie den Arretierungsschieber (9) in Richtung
Bildfenster drücken.
Öffnen
Sie die beiden Andruckkufen (4 und 6) und arretieren
sie diese, indem sie den Arretierungsschieber (9) in Richtung
Bildfenster drücken.
Einlegen einer 30 m Tageslichtspule in die Kamera
Auch wenn die Bezeichnung etwas anderes vermuten lässt, das Einlegen von Tageslichtspulen in die Kamera sollte bei möglichst gedämpftem Licht geschehen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Kamera auf einem Stativ steht. Ziehen Sie zunächst nur den Filmanfang heraus und stecken Sie die Spule in die schwarze Hülle zurück. Belassen Sie die Spule so lange wie möglich in ihrer Verpackung.
siehe auch:
| BOLEX H16 EBM / EL | |
| BOLEX Pro /Pro 100 | |
| 16 mm-Kameras im Vergleich | |
| Technische Informationen zum Strahlenteilerprisma (englischsprachige Webseite, gehört nicht zur Datenblattsammlung) |
© Stefan Neudeck
www.filmtechnik-online.de 24.12.2001