
Die Farbtemperatur
|
Diese Seite verwendet Cookies sowie die Tracking-Software Matomo. Mit der weiteren Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Details hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung. Abschalten können Sie das Tracking hier. Möglicherweise sind die Inhalte dieser Seite technisch veraltet, verbleiben aber aus Archivgründen im Netz. Aktuelle Informationen sowie die Möglichkeit Fragen zu stellen, finden Sie unter www.frag-den-neudeck.de |
|
Startseite Frag' den Neudeck Impressum Tracking Datenschutzerklärung |

Weißes Licht gibt es eigentlich gar nicht. Es ist vielmehr das Ergebnis vieler verschiedenfarbiger, sich überlagernder Lichtstrahlen in einem Wellenlängenbereich von 400 bis 700 Nanometern.
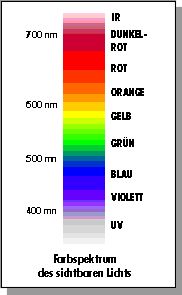 Je nach Art der Lichtquelle, kann die
spektrale Zusammensetzung, also das Mischungsverhältnis zwischen
den einzelnen Farben variieren, ohne dass das Auge einen
sichtbaren Farbstich wahrnimmt. Für die Charakterisierung einer
Lichtquelle von besonderer Bedeutung ist das Verhältnis zwischen
dem roten und dem blauen Lichtanteil. Weißes Licht mit hohem
Rotanteil wird als warmfarbig und mit hohem Blauanteil als
kaltfarbig bezeichnet. Für die Belange der Filmtechnik ist diese
Unterscheidung zu ungenau. Eine Maßzahl muss her, die das Verhältnis
genauer definiert: Die Verteilungs-
oder Farbtemperatur (1)
Je nach Art der Lichtquelle, kann die
spektrale Zusammensetzung, also das Mischungsverhältnis zwischen
den einzelnen Farben variieren, ohne dass das Auge einen
sichtbaren Farbstich wahrnimmt. Für die Charakterisierung einer
Lichtquelle von besonderer Bedeutung ist das Verhältnis zwischen
dem roten und dem blauen Lichtanteil. Weißes Licht mit hohem
Rotanteil wird als warmfarbig und mit hohem Blauanteil als
kaltfarbig bezeichnet. Für die Belange der Filmtechnik ist diese
Unterscheidung zu ungenau. Eine Maßzahl muss her, die das Verhältnis
genauer definiert: Die Verteilungs-
oder Farbtemperatur (1)
Als Referenzobjekt dient ein imaginärer schwarzer Körper, der auf Grund seiner Beschaffenheit keine Lichtstrahlen reflektiert. Um es gleich vorweg zu nehmen, einen solchen Körper gibt es nicht, man kann ihn sich jedoch ersatzweise als Hufeisen vorstellen. Bei Raumtemperatur ist er vollkommen schwarz. Erhitzt man ihn, so beginnt er irgendwann, Licht auszusenden. Zunächst glüht er nur leicht, das ausgesandte Licht hat einen hohen Rotanteil. Unser Hufeisen würde im Schmiedefeuer zunächst rot-, später weißglühend. Bei einer Temperatur von etwa 2500° C (= 2773 Kelvin) entspricht die spektrale Lichtverteilung der einer Haushaltsglühbirne.
Mit steigender Temperatur wird der blaue Lichtanteil immer größer. Ab hier hinkt unser Hufeisenmodell. Es würde irgendwann schmelzen, der schwarze Körper jedoch bleibt formstabil. Bei einer Temperatur von 4727° C (= 5000 Kelvin) entspricht die ausgesandte Strahlung etwa dem normalen Tageslicht.
(1) Manche Fachleute verwenden den Begriff Farbtemperatur nur bei diskontinuierlichen Spektren, deren Farbwirkung sich mit der eines Temperaturstrahlers vergleichen lässt (z.B. HMI-Lampen) Für kontinuierliches Spektren wird der Begriff Verteilungstemperatur verwendet. Diese Unterscheidung ist jedoch praxisfern. Wir verwenden hier daher unabhängig von der sonstigen spektralen Zusammensetzung nur den Begriff Farbtemperatur. ZURÜCK
siehe auch:
| Bestimmung des erforderlichen Filterwertes zur Korrektur der Farbtempeartur |
© Stefan Neudeck
www.filmtechnik-online.de